„EINE BRÜCKE IN DIE WELT BAUEN“
Nachgefragt: Nicht sehen und nicht hören zu können, erschwert Kommunikation und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erheblich. Das Projekt GaViD-Sinne bietet hier Hilfe an. Projektleiterin Tabea Sadowski und Johannes Spielmann erklären, warum auch Angehörige davon profitieren. Von Sara Sophie Fessner
„Ganzheitliche Versorgungsstützpunkte und interdisziplinäre Diagnostik für Menschen mit Sinnesbehinderungen“ oder kurz GaViD-Sinne: Was verbirgt sich hinter diesem Projekt?
Sadowski: Menschen mit Mehrfachbehinderungen werden oft nicht adäquat versorgt, mögliche Sinnesbehinderungen gar nicht richtig diagnostiziert. Der Personenkreis mit einer Mehrfachbehinderung weiß also häufig gar nicht, dass eine Seh- und / oder Hörbeeinträchtigung vorliegt, weil die notwendige Diagnostik in der regulären Versorgung nicht stattfindet.
Spielmann: Wir wissen aus einer recht aktuellen Studie, gefördert vom bayerischen Gesundheitsministerium, dass bei Menschen mit einer geistigen oder einer Mehrfachbehinderung auch mindestens einer der beiden Fernsinne, ganz oft aber beide, das Sehen und das Hören, beeinträchtigt sind.
Wie ist es denn möglich, dass diese Beeinträchtigungen in vielen Fällen nicht diagnostiziert werden?
Spielmann: Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen haben oft keine Möglichkeit, sich verbal auszudrücken. Auch wenn die Behinderungen körperlich sehr beeinträchtigen, etwa beim Atmen, drängt sich das so in den Vordergrund, dass man über die vermeintlich „leisen“ Sinne, wie Sehen oder Hören, gar nicht nachdenkt.
Sadowski: Erstmal braucht es eine Person, die auf die Beeinträchtigung aufmerksam wird. Wenn dieser erste Meilenstein geschafft ist, braucht es eine Anlaufstelle, die adäquat überprüft, ob tatsächlich eine Beeinträchtigung vorliegt. Eine Stelle, bei der das Personal in der Lage ist, sich auf die Art von Kommunikation mehrfachbehinderter Menschen einzulassen. Um festzustellen, dass ein Mensch mit Mehrfachbehinderungen seh- oder hörbehindert ist, braucht es viel Zeit. Die haben die Regelsysteme nicht.
Und genau an diesem Punkt setzt GaViD-Sinne an?
Sadowski: Genau, GaViD-Sinne ist ein deutschlandweites Projekt, gefördert vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses, um ebendiese Versorgungslücke im deutschen Gesundheitssystem zu schließen. An vier Standorten in Deutschland, einschließlich Würzburg mit der Blindeninstitutsstiftung und der Uniklinik Würzburg sowie in Stuttgart, Berlin und Hannover, haben sich Facheinrichtungen mit Universitätskliniken zu Diagnostik- und Versorgungsstützpunkten zusammengeschlossen. Dort versuchen wir eine Atmosphäre und ein Untersuchungssetting zu schaffen, in dem wir Stressfaktoren minimieren. Wir haben entspannte Räumlichkeiten, wir haben eine entspannte Atmosphäre, wir nehmen uns die Zeit, um Untersuchungen überhaupt erstmal durchzuführen.
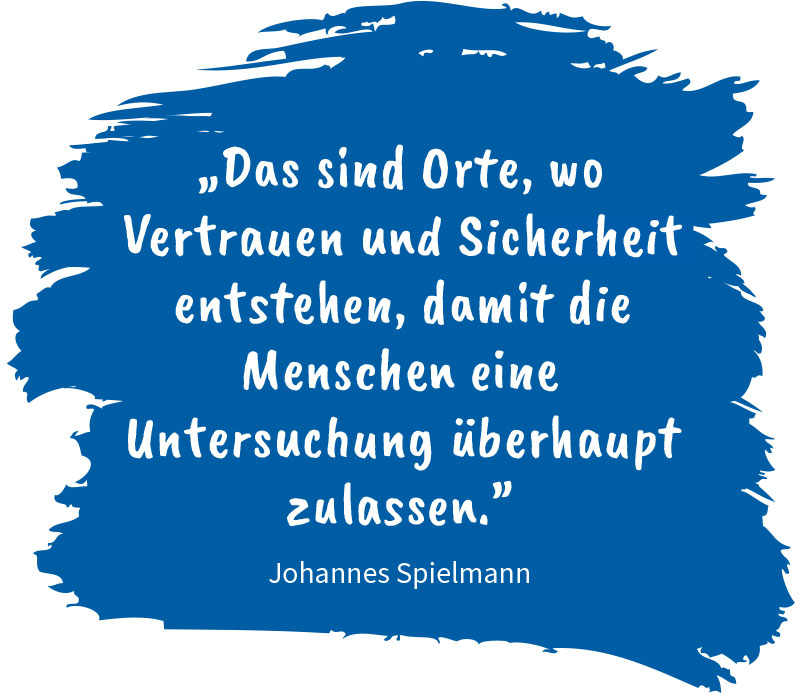
Spielmann: Zwei Stichworte sind ganz wichtig: Das sind Orte, wo Vertrauen und Sicherheit entstehen, damit die Menschen die Untersuchung überhaupt zulassen. Eine Voraussetzung, dass Diagnostik passieren kann.
„Menschen, die nicht hören oder sehen können, verlieren Beziehungen“, betont Johannes Spielmann.
Wie können Sie sicherstellen, dass die Menschen überhaupt das Projekt GaViD-Sinne nutzen?
Spielmann: Wir versuchen ganz viele Kooperationspartner und -partnerinnen zu sensibilisieren, von der Frühförderung bis zu Senioreneinrichtungen. Das Tragische ist ja, wenn man um die Beeinträchtigung dieser beiden Fernsinne weiß, gibt es viele Hilfsmittel, die den Menschen die Brücke in die Welt zurückbauen. Mich beeindruckt da immer ein Satz der taubblinden Schriftstellerin Helen Keller: „Blindheit trennt von der Welt, Taubheit von den Menschen.“ Das müssen wir uns klarmachen: Dort, wo Menschen nicht oder nicht ausreichend sehen und hören, rücken sie immer ein Stück weiter aus dem sozialen Zusammenhang raus und verlieren Beziehungen. Daraus entstehen viele psychische Probleme.
Sadowski: Es geht daher wirklich um die Sensibilisierung. Sie haben gefragt: Wie kommen wir an die Menschen? Wir müssen öffentlichkeitswirksam werden. GaViD-Sinne ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Wir brauchen keine ärztliche Überweisung, damit jemand zu uns kommen darf. Es darf sich jeder, auch jeder Angehörige, melden, der einen Verdacht hat, und dann besprechen wir das mit ihm und machen eine entsprechende Untersuchung.
Tabea Sadowski (Mitte) und Johannes Spielmann erläutern Sara Sophie Fessner im Interview, welche Ziele GaViD-Sinne verfolgt.
GaViD-Sinne
Das Projekt „GaViD-Sinne“ fördert die interdisziplinäre Diagnostik für Menschen mit Sinnesbehinderungen in Deutschland. Es umfasst vier Versorgungsstützpunkte, die eine frühzeitige Hilfe ermöglichen. Ziel ist eine schnellere, umfassende Therapie und Kosteneinsparungen. Das Projekt läuft über 36 Monate und wird vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses unterstützt, um die Versorgung mehrfach behinderter Menschen zu verbessern.
Tabea Sadowski (Mitte) und Johannes Spielmann erläutern Sara Sophie Fessner im Interview, welche Ziele GaViD-Sinne verfolgt.
GaViD-Sinne
Das Projekt „GaViD-Sinne“ fördert die interdisziplinäre Diagnostik für Menschen mit Sinnesbehinderungen in Deutschland. Es umfasst vier Versorgungsstützpunkte, die eine frühzeitige Hilfe ermöglichen. Ziel ist eine schnellere, umfassende Therapie und Kosteneinsparungen. Das Projekt läuft über 36 Monate und wird vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses unterstützt, um die Versorgung mehrfach behinderter Menschen zu verbessern.
Das Projekt GaViD-Projekt möchte für Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen einen vertrauten und stressfreien Untersuchungsraum schaffen, erklären Tabea Sadowski (links) und Johannes Spielmann im Interview.

Das Projekt GaViD-Projekt möchte für Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen einen vertrauten und stressfreien Untersuchungsraum schaffen, erklären Tabea Sadowski (links) und Johannes Spielmann im Interview.
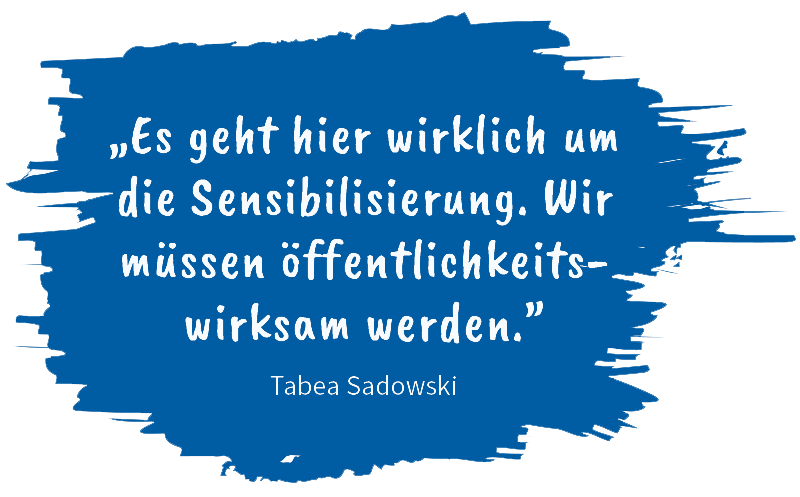
Aktuell steht GaViD-Sinne noch ganz am Anfang. Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Spielmann: Im Wesentlichen geht es darum, diese Versorgungslücke zu schließen. Wir möchten, dass Personen um sich selbst und um ihre Situation zu wissen. Häufig ist Kommunikation die Brücke zur Teilhabe und das wollen wir den Menschen ermöglichen. Darüber hinaus haben wir zum Ziel, eine langfristige Regelfinanzierung zu erhalten, damit die Versorgung auch über die drei Jahre der Projektphase hinweg gesichert ist, sodass wir dauerhaft diese Lücke schließen und eine kontinuierliche Begleitung bieten können.