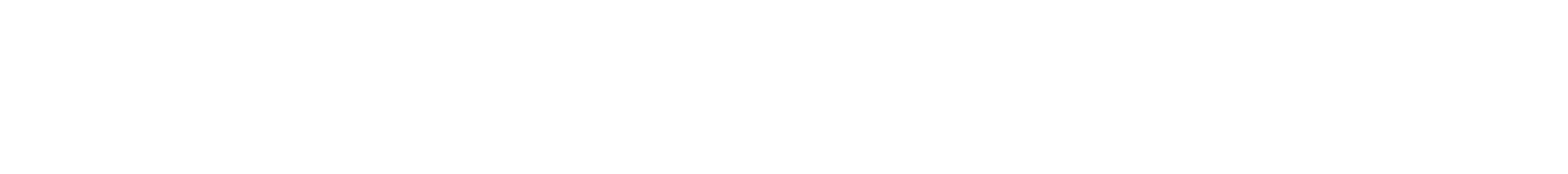

VERTRAUEN ALS DAS A UND O
Vorgestellt: In der EUTB nimmt man sich des ganzen Lebens eines behinderten Menschen an. Von Pat Christ
Mit Englisch und Gesten hatte sich Dragos A. (Name geändert) beim ersten Treffen verständlich zu machen versucht. „Ich brauch’ Arbeit!“ Das war, was Martin Haack von der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) „Sehen+“ in München schließlich verstand. Schwer seh- und gehbehindert war der junge Mann. Und sprach kaum Deutsch. „Vor einiger Zeit war er mit seiner Mutter aus Rumänien nach München gekommen“, erzählt Martin Haack. Die finanzielle Situation der Familie war prekär.
Mit Putzjobs gelang es der Mutter des 30-Jährigen, die Miete für die Einzimmerwohnung, in der die zwei lebten, zu verdienen. Beide wussten nicht, dass es ein Jobcenter und Bürgergeld gibt. Nur das Arbeitsamt kannte Dragos A. „Dort verwies man ihn auf einen Job als Lagerhelfer, doch wie soll das gehen, wenn jemand fast nichts sieht“, berichtet Martin Haack. Das Beispiel zeigt, wie anspruchsvoll die Arbeit in einer EUTB ist. Kein Beratungsfall gleicht dem anderen. Eher selten geht es um eine einzelne Frage. Viele Ratsuchende stehen vor vielfachen Hürden. Ihr ganzes Leben muss einbezogen werden.
Dragos A. zum Beispiel hätte niemand den Vorwurf machen können, er hätte sich zu wenig darum gekümmert, Hilfen wie Bürgergeld zu erhalten. Woher hätte er wissen sollen, dass es das gibt? Damit steht er nicht alleine. Ein vergleichsweise hoher Anteil an den 524 Beratungen, die in der EUTB „Sehen+“ 2024 registriert wurden, entfiel auf Migrantinnen und Migranten. Kürzlich beriet Martin Haack zum Beispiel eine libysche Familie: „Die 15-jährige Tochter war mehrfachbehindert, hatte aber keinen angepassten Rollstuhl.“ Dank der EUTB erhielt sie den endlich vom Bezirk genehmigt.
Immer wieder hat es Martin Haack auch mit Klienten zu tun, die noch unter der Schockwirkung einer schlimmen Diagnose stehen. Anna S. (Name geändert) zum Beispiel. Die 65-Jährige erfuhr, dass sie an Makuladegeneration leidet. „Sie will keinesfalls ins Pflegeheim“, so der Teilhabeberater. Martin Haack besuchte Anna S. Er sah sich unter anderem die Küche an: Auch bei schwindender Sehkraft soll Anna S. noch kochen können, ohne sich zu verbrennen. Markus Haack bemerkte außerdem, dass die Beleuchtung in der Wohnung geändert werden müsste. Und er gab praktische Tipps: „Stellen Sie den weißen Suppenteller besser auf eine schwarze Unterlage.“
Martin Haack hat es mit Menschen zu tun, denen aufgrund einer Behinderung plötzlich Berufsunfähigkeit droht. Und er berät Angehörige mehrfachbehinderter Kinder, die vor Fragen stehen, die für sie alleine unlösbar sind. Obwohl die Teilhabeberatung ans Blindeninstitut angegliedert ist, kann sich jeder mit jeder Art von Behinderung oder chronischer Krankheit an die Einrichtung wenden. Zu 30 Prozent kommen Betroffene in die EUTB. Zu 40 Prozent Angehörige: „In 30 Prozent der Fälle handelt es sich um Informationsanfragen.“
Vertrauen steht am Anfang der Beratungsarbeit der EUTB. Schließlich geht es um den ganzen Menschen.
Ein Mensch, der neu erkrankt oder neu mit einer Behinderung fertig werden muss, quält sich oft mit Zweifeln: Werde ich mein Leben weiterhin bewältigen können? Werde ich jemals wieder glücklich sein? Psychosoziales spielt neben Fragen zu Hilfsmitteln oder sozialrechtlichen Ansprüchen eine nicht unbedeutende Rolle: „Gerade, wenn es um Erkrankungen wie Multiple Sklerose geht.“ In solchen Fällen verweist Martin Haack auf Selbsthilfegruppen. Die von Makuladegeneration bedrohte Anna S. erhielt Tipps zu Seniorenangeboten, um Vereinsamung vorzubeugen.
Das A und O in der Beratungsarbeit besteht darin, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, damit ein Ratsuchender auch ein Thema berühren kann, das sehr persönlich, ja intim ist. Teilhabeberatende schaffen das, denn sie sind „besondere“ Menschen. Viele, so auch Martin Haack, haben keine Berufsausbildung im sozialen Bereich, was im Konzept so vorgesehen ist. Als Peers sollen Beratende Erfahrung mit Behinderung mitbringen – persönlich oder im familiären Kontext. „Außerdem durchlaufen wir eine Qualifizierung“, berichtet Martin Haack, der selbst studierter Historiker ist. Schließlich lernt er mit jeder einzelnen Beratung hinzu. Und vergrößert so kontinuierlich sein Wissen.

Vertrauen steht am Anfang der Beratungsarbeit der EUTB. Schließlich geht es um den ganzen Menschen.
Ein Mensch, der neu erkrankt oder neu mit einer Behinderung fertig werden muss, quält sich oft mit Zweifeln: Werde ich mein Leben weiterhin bewältigen können? Werde ich jemals wieder glücklich sein? Psychosoziales spielt neben Fragen zu Hilfsmitteln oder sozialrechtlichen Ansprüchen eine nicht unbedeutende Rolle: „Gerade, wenn es um Erkrankungen wie Multiple Sklerose geht.“ In solchen Fällen verweist Martin Haack auf Selbsthilfegruppen. Die von Makuladegeneration bedrohte Anna S. erhielt Tipps zu Seniorenangeboten, um Vereinsamung vorzubeugen.
Das A und O in der Beratungsarbeit besteht darin, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, damit ein Ratsuchender auch ein Thema berühren kann, das sehr persönlich, ja intim ist. Teilhabeberatende schaffen das, denn sie sind „besondere“ Menschen. Viele, so auch Martin Haack, haben keine Berufsausbildung im sozialen Bereich, was im Konzept so vorgesehen ist. Als Peers sollen Beratende Erfahrung mit Behinderung mitbringen – persönlich oder im familiären Kontext. „Außerdem durchlaufen wir eine Qualifizierung“, berichtet Martin Haack, der selbst studierter Historiker ist. Schließlich lernt er mit jeder einzelnen Beratung hinzu. Und vergrößert so kontinuierlich sein Wissen.